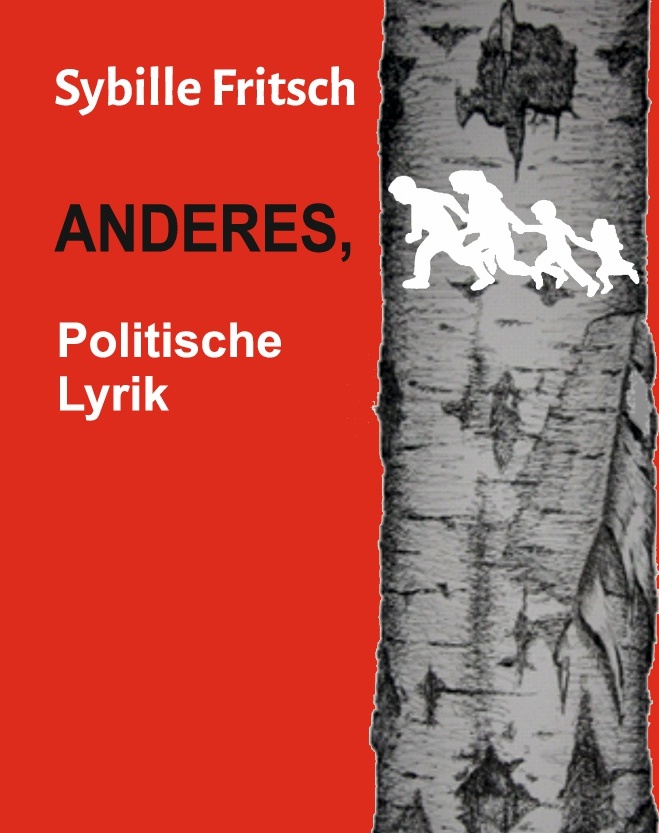KIEW/BERLIN – Während der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in sein viertes Jahr geht, offenbart dieser Winter eine humanitäre Krise von beispiellosem Ausmaß. Im Podcast Conny & Kurt berichtet Andrij Waskowycz, Büroleiter der Diakonie Katastrophenhilfe in Kiew. Die klimatischen Bedingungen, mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad, treffen auf eine durch ständigen Beschuss systematisch geschwächte zivile Infrastruktur. In Städten wie Kiew harren Menschen in Hochhäusern ohne Strom und Wasser bei Temperaturen von lediglich drei Grad in ihren Wohnungen aus. Besonders dramatisch ist die Lage für Ältere in den oberen Stockwerken: „Der Aufzug fährt ja auch nicht, wenn kein Strom da ist. Und die sind quasi eingeschlossen“, beschreibt die Lage vor Ort die Not derer, die ohne fremde Hilfe kaum überleben könnten.
Andrij Waskowycz, zeichnet ein Bild, das über die üblichen Fernsehberichte hinausgeht. Er spricht von Kindern, die in eiskalten Wohnungen unter mehreren Schichten Kleidung versuchen, am Online-Unterricht teilzunehmen. Um dieser Not zu begegnen, setzt die Organisation verstärkt auf Bargeldhilfe und Gutscheine. „Sie beachtet vor allen Dingen die Würde der Menschen. Die Menschen bleiben selbständig“, so Waskowycz. Mit diesen Mitteln beschaffen sich die Betroffenen das Nötigste: Heizgeräte, Brennstoffe, warme Decken oder Lebensmittel.
Trotz einer beachtlichen Spendenbereitschaft, – seit 2022 flossen allein über die Diakonie Katastrophenhilfe fast 79 Millionen Euro – bleibt die Hilfe angesichts der schieren Masse an Bedürftigen oft nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“, so Martin Keßler, Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe. Die staatlichen Strukturen sind nach Jahren des Krieges finanziell überfordert.
Erschwerend kommt die Lage der rund 3,7 Millionen Binnenvertriebenen hinzu. Viele von ihnen kehren mangels Perspektive in unsichere, umkämpfte Gebiete zurück. Neben der materiellen Not wiegt die psychische Last schwer: Schätzungsweise 15 Millionen Ukrainer benötigen psychosoziale Betreuung. Experten warnen, dass das Versäumnis intensiver humanitärer Hilfe weitreichende Folgen haben könnte. Sollte die Versorgung kollabieren, drohe eine neue, massive Fluchtbewegung gen Westen. Bisher dominiert jedoch oft das Gefühl einer verzögerten Unterstützung: „Zu wenig, zu spät, das gilt eigentlich ja für die ganzen vier Jahre“, so Kurt-Helmuth Eimuth.
Spendenkonto der Diakonie Katastrophenhilfe
Evangelische Bank
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
BIC: GENODEF1EK1