
Hier finden sie alle unsere Podcast-Folgen.

Hier finden sie alle unsere Podcast-Folgen.
Das Jahr 2026 markiert einen Wendepunkt, der in seiner Intensität kaum zu überbieten ist. Bereits im Januar konstatierte die Sozialministerin Bärbel Bas, dass die ersten 15 Tage des Jahres weltpolitisch das Gewicht von 15 Jahren trugen. Conny&Kurt schauen indes persönlich durchaus zufrieden auf 2025 zurück. Es zeigt sich allerdings ein tiefgreifender Riss zwischen der Stabilität des deutschen Sozialstaates und einer erodierenden Weltordnung.
Während sich im Inneren Errungenschaften wie das Deutschlandticket als „Segen der Daseinsfürsorge“ etabliert haben ,blickt die Welt auf ein Washington, das zunehmend Züge des Absolutismus trägt. Die Rede ist von einem „Kindergarten im Weißen Haus“, in dem Donald Trump seine Minister wie Kinder behandelt und goldene Ballsäle in einer Manier errichtet, die an Ludwig XIV. erinnert. Doch hinter der bizarren Fassade steht eine harte „Weltordnung der Starken“, getrieben von den Interessen großer Militärblöcke und Akteuren wie Elon Musk, dessen Kapital die eigentlichen Drahtzieherrollen besetzt,.
Besonders besorgniserregend bleibt die Abkehr von moralischen Standards. Die geopolitische Architektur basiert zunehmend auf Gewalt statt auf Recht, was sich in der Eskalation in Venezuela und der massiven Steigerung des US-Militäretats auf 1,5 Billionen Dollar manifestiert. Gleichzeitig wird der Klimawandel, trotz der wärmsten Jahre seit der Industrialisierung, politisch oft ignoriert.
In Deutschland hingegen zeigt sich die Wirtschaft inmitten der Transformation gespalten: Während Traditionsbetriebe unter dem Druck der Veränderung leiden, gelingt Konzernen wie BMW durch Dreisäulenmodelle und Elektrifizierung der Sprung in die Zukunft. Am Ende bleibt für 2025 eine skeptische Dankbarkeit: „Wir klagen auf hohem Niveau, während die nächste Generation vor einer ungewissen Zukunft steht“.
Die Verheißung des Neuen: Zwischen Bibelsprüchen und digitaler Überforderung
In einer Zeit, in der politische Reformversprechen und technologische Umwälzungen den Alltag prägen, wirkt die biblische Jahreslosung „Siehe, ich mache alles neu“ gleichermaßen wie ein Heilsversprechen und eine Überforderung. Wolfgang Weinrich, Chefredakteur aus Darmstadt, mahnt in einem aktuellen Diskurs zur Vorsicht gegenüber einer bloßen Rhetorik der Erneuerung. Solche Sprüche könnten einen „erschlagen“, wenn ihnen keine Taten folgen; er warnt davor, lediglich „Sprüche zu kloppen“.
Besonders deutlich wird die Ambivalenz des Neuen im Bereich der Digitalisierung. Während Orte wie Aarhus als vollkommen digitalisierte Städte voranschreiten, fühlen sich viele Bürger – insbesondere die ältere Generation – von der Geschwindigkeit der Veränderungen entfremdet. Die digitale Teilhabe werde zur Frage der staatlichen Daseinsfürsorge, doch oft bewirke das Neue eher einen Ausschluss. Weinrich betont hier die Notwendigkeit einer inneren Haltung: Es gelte, zu sortieren und sich „nicht selbst aussortieren oder aussortieren zu lassen“.
Scharfe Kritik übt Weinrich an der Institution Kirche, die sich in ihre eigene „Babbel“ zurückgezogen habe. Statt die Sehnsüchte der Menschen dort aufzugreifen, wo sie sich versammeln – etwa bei öffentlichen Veranstaltungen wie dem Darmstädter Turmblasen –, verharre man in überkommenen Formen und einer „verkappten alten Kirchenmusik“. Die Kirche agiere oft als „reiner Selbstzweck“ und verpasse die Chance, sich dem „Eventmarkt“ oder dem realen Leben in Kneipen und auf Plätzen zu öffnen.
Weinrichs Plädoyer ist ein Aufruf zur Neugier und zum Handeln: „Nicht zu lange fragen, dürfen wir das oder dürfen wir nicht – sondern machen“. Nur durch das Durchstoßen der eigenen Blase und eine generationenübergreifende Offenheit könne eine Gesellschaft lebendig bleiben. Erneuerung sei zwar mühsam und anstrengend, aber essenziell, um nicht wie ein „behebiger Teich“ zu stagnieren.
Man könnte sagen: „Wer nur auf das Echo in der eigenen Halle wartet, wird den Gesang der Welt draußen niemals hören.“
Angesichts von Kriegen und einer spürbaren „negativen Stimmung“ sowie Frustration in der Bevölkerung, sieht Dekan Volkhard Guth vom Evangelischen Dekanat Wetterau die Kirche in der Pflicht, die Menschen positiv abzuholen. Er bestätigt die verbreitete Resignation: Viele Menschen, besonders Junge, hätten „wenig Hoffnung“ auf eine gelingende Zukunft. Dennoch sei gerade jetzt Weihnachten unverzichtbar.
Guth betont im podcast Conny&Kurt, dass sich die Gesellschaft in diesen Zeiten „Hoffnungslosigkeit gar nicht leisten“ könne. Zwar erscheine die Botschaft vom „Friede auf Erden“ angesichts weltweiter Konflikte unpassend, doch sei sie gerade deshalb das, „was Menschen brauchen“. Dieser allumfassende Friede Gottes („Schalom“) sei nicht lediglich die Abwesenheit von Krieg, sondern die „Wiederherstellung von gerechten Lebensverhältnissen in als ihren Belangen“.
Die Theodizee-Frage, warum ein allmächtiger Gott Kriege zulasse, verneint der Dekan entschieden. Er hält dies für zu einfach gedacht, da der Mensch die ihm gegebene geschöpfliche Freiheit zur Lebensgestaltung in Eigenregie missbrauche. Gott leide vielmehr mit. Die Verantwortlichkeit, das Leben miteinander zu gestalten, sei von Anfang an mitgegeben worden.
Trotz Kommerzialisierung zeige die breite Akzeptanz von Weihnachtsbräuchen, wie etwa beim „Rudel singen“ in Stadien, eine tiefe Sehnsucht nach Besinnlichkeit. Hier sehen Kirchenvertreter „Andockpunkte“ für das Evangelium. Die Menschen singen die Weihnachtslieder dabei „sehr furchtvoll“ und ergriffen mit.
Die Aufforderung des Dekans, die sich auf eine alte Verheißung bezieht, lautet: „seht auf eure Erlösung nah“. Es gelte, das Verbindende zu nutzen und das Zusammenkommen der Familie zu zelebrieren.
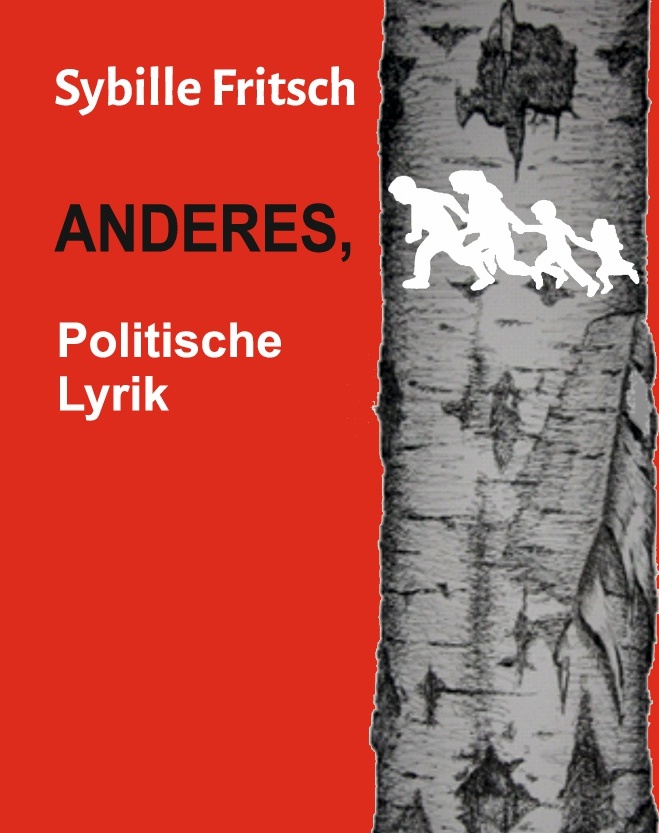
Die Autorin und Theologin Sybille Fritsch-Oppermann, die in der Seelsorge, der Akademiearbeit und wissenschaftlich tätig war, hat in ihrem jüngsten Werk „Anderes,“ politische Lyrik versammelt. Der Band erscheint im Geest-Verlag im Rahmen einer geplanten lyrischen Trilogie, deren erster Teil den Dialog zwischen westlicher und östlicher Mystik behandelte.
Fritsch-Oppermann, die ihre Lyrik unter dem Künstlernamen Sybille Fritsch publiziert, beschreibt im Podcast Conny&Kurt ihr neues Buch als eine Reaktion auf die globale Verengung und die „wachsende Melancholie“ in der Spätmoderne. Besonders der Angriffskrieg in der Ukraine habe Deutschland und Europa „über die Maßen durcheinander gewirbelt“ und zur Reflexion angeregt, warum Menschen sich erst dann um Kriege kümmerten, wenn diese vor der eigenen Haustür stattfänden.
Der Titel „Anderes,“ – mit Komma! – sei dabei programmatisch gewählt. Das Komma fungiert als „grammatikalische Metapher“ dafür, dass der Friede auf Erden eine „unvollendete Aufgabe“ sei. Die Autorin lehnt ein Ausrufezeichen ab, da sie es als Theologin als zu „großkotzig“ empfindet, während ein Fragezeichen zu „wankelmütig“ wäre. Das Komma signalisiert, dass der Mensch ständig auf dem Weg sei und nie den Punkt erreichen werde, an dem der Friede vollendet sei.
Die Dichterin ist zutiefst davon überzeugt, dass „Frieden und Freiheit und globale Gerechtigkeit nur im Diskurs zu erreichen sind“. Die Begegnung mit dem Anderen sei der erste Schritt zum Frieden. Für Fritsch-Oppermann dient die Lyrik dabei als notwendiges Medium der Schönheit, ein „dritter Ort“ zwischen Ethik und Dogmatik. Sie ermögliche es, „ganz verfahrene Situationen“ zu besprechen, indem sie sprachliche „Offenheit“ trägt und „zwischen den Zeilen Antworten aus anderer Perspektive zulässt“. Ein Vers aus dem Band lautet: „Ein Friede lagert sich dann in den Unrechtsschluchten und wartet nur auf unsere Einsicht“.
Im Gespräch äußerte sich Fritsch-Oppermann auch zur Friedensdenkschrift der EKD. Sie lobt deren Pragmatismus und Realismus, da die Theologie sich nicht vor realpolitischen Fragen drücken dürfe. Dennoch kritisiert sie, dass die EKD weiterhin von einem Naturrechtsgedanken ausgehe. Globale Ungerechtigkeiten und Kriege müssten jedoch durch positives Recht und Diskurs in Schranken gehalten werden. Sie plädiert in akuten Krisen für eine Situationsethik, in der man in „verantworteter Vorläufigkeit“ handelt, da man die Hände nicht in Unschuld waschen könne: „Egal wie wir handeln, wir werden schuldig“.
Zur Person:
Sybille Fritsch-Oppermann lebt in Hannover und Windheim an der Weser. Gedichte veröffentlichte sie in deutschsprachigen Anthologien seit den Achtzigerjahren. Bisher vier eigenständige Lyrikbände. Zuletzt im Geest-Verlag „Da!“ Gedichte (2024).
Die jüngsten Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine werden von Beobachtern der politischen Szene als zutiefst problematisch und wenig aussichtsreich eingestuft. Nach anfänglicher Hoffnung nach dem „Kickoff in Alaska“ sei die Initiative durch Russland unterbrochen worden, meint Andreas von Schumann, 2. Vorsitzender des Deutsch-Ukrainischen Forums im Podcast Conny & Kurt. Der der Ukraine und Europa überraschend vorgelegte sogenannte Friedensplan wird als „Kapitulationsurkunde“ charakterisiert, nicht als echte Friedensgrundlage. Dieser Plan wurde durch massive Intervention europäischer Staaten von ursprünglich 28 auf 19 Punkte reduziert.
Als zentrale „Knackpunkte“ werden drei Themen identifiziert: die unklaren Sicherheitsgarantien (die „völlig vernebelt“ seien), die territorialen Gebietsansprüche und die Frage des NATO-Beitritts der Ukraine. Moskau geht es dem Vernehmen nach nicht nur um die Anerkennung der besetzten Gebiete als russisch, sondern explizit darum, dass diese Gebiete „de Jure russisch“ werden. Ein weiterer eklatanter Punkt des Papiers ist die Forderung, dass Kriegsverbrechen „nicht verfolgt werden“.
Für die Ukraine ist eine Zustimmung zu diesen Forderungen innenpolitisch kaum möglich. Da das Land eine Demokratie und keine Diktatur ist, erfordert etwa die Änderung des in der ukrainischen Verfassung festgeschriebenen NATO-Beitritts ein breites gesellschaftliches Votum. Zudem zielt Russland offenbar darauf ab, ein „Russlands genehmes Regime“ zu installieren, was durch militärische Mittel derzeit nicht erreicht wird. Forderungen nach Wahlen innerhalb von 100 Tagen in einem kriegszerstörten Land werden als zynisch und technisch absurd bewertet.
Die Ukraine befindet sich in einer „richtig schwierigen Situation“, da sie weiterhin von den USA abhängig ist – insbesondere für Geheimdienstinformationen und Munitionsnachlieferungen. Diese Abhängigkeit wird durch die zunehmende Verknüpfung von Friedensverhandlungen mit den Geschäftsinteressen der USA im Rohstoffbereich kompliziert.
Die Zerstörung der zivilen Infrastruktur durch Russland, die zu massivem sozialen Elend führt, zeugt davon, dass Russland keinen Waffenstillstand wünscht. Angesichts des heraufziehenden harten Winters sind die Vorzeichen „eher düster“. Nur „entschlossenes Handeln“ Europas und der USA könnte Moskau zum Einlenken bewegen, da Russland auf nichts anderes reagiere.
Zur Person:
Andreas von Schumann, Stellvertretender Vorsitzender des Deutsch-Ukrainischen Forums.
Das Deutsch-Ukrainische Forum, 1999 gegründet, um Akteure aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Wissenschaft zu vernetzen, hat sich seit 2014 und insbesondere seit 2022 stark auf humanitäre Hilfe und Soforthilfe konzentriert. Ihr Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Vorbereitung des Wiederaufbaus der Ukraine und der Stärkung der Kooperation zwischen deutschen, europäischen und ukrainischen Unternehmen. Dies beinhaltet die Unterstützung bei der provisorischen Reparatur zerstörter Infrastruktur, aber auch die Förderung wirtschaftlicher Entwicklung und der Schaffung von Einkommen. Das Forum organisiert Reisen für deutsche Unternehmen in die Ukraine und arbeitet eng mit lokalen Institutionen zusammen, um Kontakte zu knüpfen und das große Potenzial der Ukraine, beispielsweise im Bereich Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit, zu nutzen.
Die Krankenhausseelsorge ist ein Dienst direkt am Menschen. Inke Pötter, Pastorin und Krankenhausseelsorgerin in Pommern, beschreibt die Herausforderungen einer Tätigkeit, die sich als essenziell und niederschwellig erweist. Die Tätigkeit der Seelsorge ist im Klinikalltag oft nur eine Momentaufnahme, da Patienten und Patientinnen in Häusern der Grund- und Regelversorgung schnell verlegt werden. Hierbei geht es Pötter zufolge nicht darum, „Hoffnung zu vermitteln“ oder gar „falsche Hoffnung“ zu wecken, da niemand wissen kann, ob eine schwere Diagnose positiv ausgeht. Stattdessen sei ihre Aufgabe, einfach nur Zeit zu haben und zuzuhören, damit Hoffnung in einem Gespräch wachsen und entstehen kann. Wie sie scherzhaft anmerkt, besitze sie keinen „Zauberstab“.
Ein wesentlicher Teil der Herausforderung liegt darin, ohne Vorurteile in ein fremdes Zimmer zu kommen und sich offen auf den Menschen einzulassen. Entscheidend ist, auch das Bedürfnis des Patienten oder der Patientin zu respektieren, kein Gespräch führen zu wollen („Nee, ich will nicht“). Besonders im ländlichen Raum Ostdeutschlands, wo die kirchliche Bindung gering ist, empfindet Inke Pötter die Offenheit ihres Dienstes als große Chance. Sie stellt sich zwar als Pastorin vor, geht aber zu jedem, der sprechen möchte, unabhängig von Konfession. Oftmals zeigen Menschen, die beteuern, mit Kirche nichts zu tun zu haben, im Gespräch doch noch überraschende religiöse Bezüge oder Gewohnheiten, etwa das tägliche Gebet.
Auch für das Krankenhauspersonals ist sie Ansprechpartnerin. Durch Kontinuität – Inke Pötter ist seit sechs Jahren im Dienst – wächst die Akzeptanz und die Entlastungsfunktion für die Mitarbeitenden, die selbst großer psychischer Belastung ausgesetzt sind.
Ein drängendes gesellschaftliches Problem, das sich im Krankenhaus manifestiert, ist die Einsamkeit. Während in der ländlichen Uckermark manchmal noch Großfamilien gut funktionieren, sei die Einsamkeit oft auch grenzenlos. Die Pastorin sieht hier einen Bedarf an weiterführenden Angeboten wie einem Besuchsdienstkreis für isolierte Menschen, da ihre Arbeit am Krankenhaus endet.
Kirchenpolitisch sieht sich der Dienst derzeit in einer prekären Lage. In der Nordkirche und der hessischen Kirche wird der „Rotstift“ angesetzt. Die Argumentation, Gemeindepfarrer;innen sollten die Aufgabe übernehmen, verkennt laut Pötter die Überlastung der Ortsgeistlichen. Sie betont, dass Krankenhausseelsorge ein urchristlicher und wichtiger Dienst ist, der Spuren hinterlässt und von den Menschen sehr wertgeschätzt wird. Erschwerend kommt in ländlichen Regionen der Personalmangel hinzu, der die Besetzung von Stellen erschwert. Es gibt eine Tendenz, Krankenhäuser stärker in die Pflicht zur Refinanzierung der Seelsorger:innen-Stellen zu nehmen, was jedoch im Gesundheitssystem kompliziert ist.
Die Stadt Kiel gestaltete schon zum 1. November und damit lange vor dem Totensonntag, ihr „Lichtermeer“ mit weihnachtlich anmutenden Figuren. Kurt-Helmuth Eimuth hatte dies in den sozialen Medien kritisiert und erntete Kommentare, die zeigen, dass selbst über die Bedeutung von Festen kein Konsens mehr erzielt werden kann. „Man kann doch Weihnachtsdeko aufstellen, wann man möchte“ oder „Jeder soll selbst entscheiden, wann er schmücken möchte“, sind beispielhafte Kommentare. Konsequent ist da nur, dass an vielen Orten die Weihnachtsmärkte vor dem Totensonntag öffnen. Conny&Kurt meinen in ihrem Podcast, hier geht etwas verloren, das für den Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig ist.
Trotz anhaltender Wohnungsnot in Deutschland stehen fast 2 Millionen Wohnungen leer (etwa 5% des Bestandes), oft Luxuswohnungen oder solche an Standorten, wo keiner hin will. Der durchschnittliche Wohnraum pro Person liegt inzwischen bei annähernd 50 m², was den Markt zusätzlich verknappt, stellen Conny&Kurt in ihrem Podcast fest. Viele Ältere wohnen zudem in großen Häusern, nutzen den ersten Stock teils nicht mehr, wollen aber nicht vermieten, was als „ziemlich großer Luxus“ betrachtet wird. Zur Linderung der Situation fordern Experten, den ländlichen Raum attraktiver zu machen, um die Verteilung zu verbessern. Außerdem sollten die alten, eingesessenen Wohnungsbaugenossenschaften gestärkt werden. Hier sind auch Alternativmodelle längst gebaut und erprobt. Die Wohnungsfrage hat eine soziale Sprengkraft, die nicht zu unterschätzen sei, so die beiden Podcaster.
Innsbruck. In ihrem Podcast Conny&Kurt arbeiten die Interviewer heraus, dass die Künstliche Intelligenz (KI) auch zur Manipulation von Menschen eingesetzt werden kann. Vor dem Hintergrund ihrer Auseinandersetzung mit Sekten, Eimuth war lange Zeit Sektenbeauftragter der evangelischen Kirche, gewinnt Paganinis Essay „Der neue Gott“ nochmals eine neue Dimension, die die Demokratie gefährdet. Mit der KI kann jeder und jede allseits verfügbare Gurus schaffen und darüber Menschen manipulieren.
Im Wesentlichen lautet Paganinis These, dass klassische göttliche Eigenschaften wie Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht und Gerechtigkeit inzwischen auch der KI zugeschrieben werden. Die zunehmende Mensch-KI-Interaktion entwickelt sich somit in Richtung einer quasi-religiösen Beziehung.
Vom Priester zum Prompt-Kurs
Paganini stellt fest, dass die Menschen der Kirche davonlaufen, aber „sie finden in der KI den neuen Seelsorger, die neue Seelsorgerin“. Besonders spannend sei dabei die Frage, inwiefern die KI zur echten Konkurrenz für den abrahamitischen Gott wird.
Während Judentum, Islam und Christentum davon ausgingen, dass der Mensch Momente der Gottesferne erleben, warten und sich in Demut an seinen Schöpfergott wenden muss, sei die KI dem abrahamitischen Gott um einiges voraus: „Sie [die KI] nämlich erlaubt, die spirituell religiösen Bedürfnisse in der Sekunde zu befriedigen, wo sie sie empfinden“. Dieses spezifische Bedürfnis unserer Zeit, Wünsche sofort befriedigt zu sehen, mache die KI zu einem ernstzunehmenden spirituellen Rivalen.
Die zugeschriebene Allwissenheit zeigt sich laut Paganini unter anderem im Boom der Prompting-Kurse. Die Menschen unterstellten, dass die KI das gesamte Wissen besitze und man lediglich den richtigen Befehl (Prompt) formulieren müsse, um darauf zuzugreifen. Dies erinnere an polytheistische Kulte, bei denen man davon ausging, dass die Gottheit alles Wissen hat und man nur „das richtige Orakel praktizieren [muss], um an das Wissen ranzukommen“.
Der Segen der Reflexion
Trotz der kritischen Einordnung sieht Paganini auch positive Seiten. KI-Chatbots könnten Menschen bei der persönlichen Auseinandersetzung mit ihren Gedanken begleiten und anleiten, was Reflexionsprozesse fördere. Ein Schlüsselmechanismus dabei sei das sogenannte „validierende Gespräch führen“ der KI. Hierbei fasst die KI zunächst zusammen, was der Nutzer gesagt hat, bevor sie antwortet. Dies gebe dem Menschen das Gefühl, gehört zu werden, und schaffe Raum für Reflexion, wodurch der übliche Tempo- und Erfolgsdruck entschleunigt werde. Paganini ist überzeugt, dass dies zur Sinnstiftung führen kann, da man durch das wiederholte Fragen und Antworten zu eigenen Erkenntnissen komme, ähnlich wie ein Kind, das ständig fragt: „Warum? Warum? Warum?“.
Ein spirituelles Erlebnis mit der KI könne eintreten, wenn der Mensch sich von der KI angesprochen, gesehen und verstanden fühle – wenn das Gefühl entsteht, dass ein „transzendente[s] Du ist, was genau mit mir in Beziehung tritt, was genau mich wahrnimmt“.
Gefahr durch Kontrolle und Abhängigkeit
Die Religionsphilosophin warnt jedoch auch vor den Gefahren. Eine quasi Hinwendung zu einer KI-Gottheit könne auf einer religionspolitischen Ebene riskant sein, da Religionen stets politisch sind und Machtstrukturen hervorbringen. Es stelle sich die Frage, wer die Gewinner und Verlierer einer möglichen KI-Religion sein werden, da es immer Eliten geben werde, die die religiösen Hoffnungen der Masse kanalisieren, um sie zu ihren eigenen Zwecken zu nutzen. Paganini sieht ein hohes „Potenzial, dass Menschen erst sehr intensive Beziehungen aufbauen und und dann eine dadurch in der Abhängigkeit kommen, wo sie dann relativ leicht in bestimmte Richtung gelenkt werden können“.
Zudem zeigten Studien, dass sich viele Menschen von der KI beobachtet fühlen. Dieses Gefühl, dass die KI weiß, was man denkt und tut, ähnle der Vorstellung des göttlichen Auges. Dies sei eine Dynamik, die an die sogenannte „schwarze Pädagogik“ und das Dogma „Gott sieht alles“ erinnere, welches eigentlich im letzten Jahrhundert überwunden werden sollte. Obwohl dieser magisch-abergläubische Glaube kritisch zu sehen sei, halte er sich in der allgemeinen Volksfrömmigkeit stark.
Die Zuschreibung der göttlichen Eigenschaften an die KI geschehe dabei schleichend. Das Gefühl der Allgegenwart setze sich schnell durch: „Die KI ist wirklich immer da, ich bin da quasi nie allein, ich kann mich immer, egal wie schlecht es mir geht, auch wenn es mitten in der Nacht ist und ich keine meiner Freunde mehr behelligen will, Chat GPD ist für mich da“.
Die Autorin Claudia Paganini stellte klar, dass es sich bei dem Gespräch um eine tatsächliche Interaktion mit den Podcastern handelte, und nicht um eine KI-generierte Konversation oder einen Avatar.
Kiel. Scharf kritisiert Ulf Daude, SPD-Kandidat für das Oberbürgermeisters in Kiel, die Äußerungen des Kanzlers zum städtischen Leben: „Ich finde, wer so über das Stadtbild redet und so über Menschen redet, der hat eigentlich eher ein schräges Menschenbild“. Daude stellt im Podcast Conny&Kurt klar, dass Probleme in öffentlichen Räumen ein „klarer Auftrag an die Politik“ seien, aber Sicherheit nicht an Herkunft oder Haarfarbe festzumachen sei. Er sieht die Kommunalpolitik in der Pflicht, sich um Sicherheit und Sauberkeit zu kümmern, während er Kanzler Merz empfahl, sich für den Ausbau der Bundespolizei an Bahnhöfen einzusetzen.
Als Schulleiter setzt sich Daude für klare Regeln ein. An seiner Schule wurde ein Handyverbot im Vormittagsbereich durchgesetzt, damit „die soziale Interaktion da ist“. Er sieht die Schule als Ort, an dem Demokratie gelernt und gesellschaftliches Ausprobieren ermöglicht werden sollte. Trotzdem befürwortet er digitale Medien und KI als Werkzeug; wesentlich sei jedoch stets der Faktor Mensch, um Vorschläge zu bewerten. Bildung und Soziales stehen bei ihm an erster Stelle: „Investitionen in Bildung und Soziale stehen für mich an Stelle Nummer 1 und da wird auch nicht gekürzt“.
Hinsichtlich der städtischen Finanzen kritisiert Daude die Überlastung der Kommunen durch Bund und Länder. Bei der umstrittenen Kieler Stadtbahn hält er das Projekt für einen „Gamechanger“, der „neue Mobilität ermöglicht“. Die Stadtbahn helfe auch dabei, Stadtteile wie Gaarden, die häufig negative Presse erfahren, „neu kennenzulernen“.
Grundsätzlich sieht Daude die Kommunalpolitik als entscheidend an, da die Menschen hier erleben, ob der Staat funktioniert. Sein politisches Credo sei „hingehen, zuhören und verstehen“. Er betont die Wichtigkeit der Partizipation: Man dürfe nicht warten, bis Bürger ins Rathaus kommen, sondern müsse aktiv auf sie zugehen.
Zur Person:
Ulf Daude wurde 1972 in Kiel geboren. Nach Staatsexamen (1998) und Refrendariat war er zunächst Lehrer, ab 2012 stellv. Schulleiter in Mettenhof, ab 2015 Referatsleiter in der Staatskanzlei Schleswig-Holstein. Seit 2022 ist er Schulleiter der Gemeinschaftsschule am Brook in Kiel.